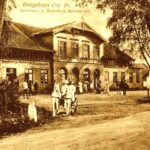Zur Geschichte des Galtgarben, Drugehnen, Wiekau, Prilacken
Der Galtgarben ist nicht nur die höchste Erhebung des Alkgebirges mit 111 Metern der höchste Berg des Samlands, sondern auch sagenumwoben. Auf ihm soll der Legende nach der Pruße Samo, ein Sohn Widiwuts und Namensgeber für das Samland, residiert haben. Die Burg, die er sich hier errichtet haben soll, nannte er der Überlieferung nach „Gayltegarwo“.
Die Prußen hatten hier jedenfalls eine Sicherungswarte installiert: wenn sich feindliche Truppen näherten, entzündete man oben ein weithin sichtbares Feuerzeichen.
In möglicher Anknüpfung an diese Befestigung legte der Orden an derselben Stelle eine große Wallburg mit vielen Wällen an, die mächtigste Wallburg des Samlands. 1278 wurde ein „castrum Rinow“ auf dem Gipfel erwähnt, im 13. Jh. hieß der Galtgarben lange Rinauer Berg. Wegen Wassermangels hatte die Burg für den Orden jedoch keinen nachhaltigen Nutzen und diente eher als Fliehburg für die lokale Bevölkerung. 1399 wurde nur noch von der ehemaligen Burg Galtgarben gesprochen.
Geologisch ist das Alkgebirge ein typischer Endmoränenzug, der ziemlich unmittelbar aus dem Flachland aufsteigt. Nach Südosten kann man vom Gipfel des Galtgarben aus die Türme von Königsberg sehen, nach Westen Fischhausen und ein wenig von der Ostsee, nach Süden und mit dem Fernglas das Frische Haff. Nach Norden ist der Ausblick durch einen Waldgürtel versperrt. Der Berg ist mit Laubwald bedeckt. Vor dem Krieg war der Galtgarben ein zentraler Ort für Sonnenwendfeiern. Heute ist der Zugang verboten. Lange Zeit und vielleicht noch immer ist der Galtgarben militärisches Sperrgebiet. Bei Hegeberg im nördlichen Teil des Alkgebirges hatte die Wehrmacht ein sehr großes unterirdisches Treibstofflager angelegt. Dieses fiel den Sowjets Ende Januar 1945 überraschend schnell in die Hände.[2]
Das von den Höhenlagen des Samlands herabfließende Wasser sammelte man im 14. Jh. in einemKomplex von 11 Teichen. Diese waren durch 3 m breite Kanäle miteinander verbunden und ein solcher Kanal, der sog. Landgraben, verlief über 15 km bis nach Königsberg, wo der Oberteich und der kleine Schlossteich als Reservoir dienten. Damit versorgte man die Burg, die Stadt und 3 an der Nord- und Ostseite der Burg gelegene Mühlen von Königsberg kontinuierlich mit Wasser. Was überschüssig war, floss in die Katzbach und von dort in den Pregel. Zunächst staute man das Wasser bei Wargen, das im Landgraben aufgenommen wurde. Als die Mengen hier nicht mehr ausreichten, wurde 1887 – 1890 eine Talsperre bei Wikau mit einem 480 Meter langen und 10 Meter ohen Staudamm gebaut, projektiert von dem Stadtbaurat Neumann. 1911 kam dann der Staudamm bei Willgaiten hinzu. Die Wasserfläche betrug dann 42 Hektar. Eine vielgestaltige Uferbepflanzung der Stauseen ließ eine sehenswerte Landschaft entstehen, die viele Ausflügler anzog.[3]
Ausgangspunkt für die Begehung des Galtgarben, solange es hier kein Sperrgebiet gab, war Pereslavskoe – Drugehnen. Das kleine Dorf wurde 1339 oder 1389 erstmalig als „Drucheyn“ urkundlich erwähnt, wobei der Name auf eine sumpfige, fieberträchtige Umgebung hinweist. Ein Ortsteil von Drugehnen liegt an der Samlandbahn und besaß einen Bahnhof.
Am nördlichen Ausläufer des Alkgebirges und nördlich von Drugehnen lag östlich der Reichsstraße 143 der Ort Seljony Gai – Drebnau. Die Landgemeinde Drebnau bestand seit 1928 aus Groß und Klein Drebnau sowie Tannenhain. Groß Drebnau wurde 1258 erstmals als Drowinenmoter erwähnt, wobei mit Drowine altpreußisch eine Beute oder ein Stock wilder Bienen bezeichnet wurde und lag somit in einem Gebiet der Bienenhaltung. 1820 zählte man im Dorf 13 Feuerstellen und 1938 hatte Groß Drebnau insgesamt 276 Einwohner. Der Erfinder der Jugendherbergsbewegung, Richard Schirrmann, war einige Zeit Hauslehrer auf einem Gut in Groß Drebnau. Klein Drebnau entstand im 15. oder 16.Jh., wurde nach 1540 erstmals urkundlich erwähnt, verfügte 1820 über 7 Feuerstellen und 1938 über 128 Einwohner. Tannenhain war noch kleiner und hatte 1938 nur etwa 30 Einwohner, beherbergte aber die einzige Jugendherberge im Innern des Samlandkreises.[4]
Ebenfalls am Galtgarben im Wiekauer Teichgebiet lag das kleine Dorf Chrustalnoje – Wiekau, das anlässlich der Landvergabe an vier Prußen 1283 erstmals seine urkundliche Erwähnung fand. Hier entdeckte man ein großes Brandgräberfeld, in dem man reiche Funde aus der älteren Bronze- und aus der Eisenzeit machte. Das spätere Königliche Dorf hatte um 1820 bei 12 Feuerstellen 96 Einwohner. 1939 wohnten hier 273 Personen. Seit König Friedrich Wilhelm I. gab es hier eine Schule, ansonsten nur Bauernhöfe, eine Gastwirtschaft und eine Schmiede.[1]
Südwestlich des Galtgarben gab es das adlige Gut Prilacken, anfangs als Vorwerk von Kragau ein bischöflicher Hausbesitz, später als Prylacken ein herzogliches Jagdhaus, 1727 an den Rittmeister von Puy verkauft, später im Besitz eines Herrn von Trippenbach und eines Ernst Dietrich von Tettau-Tolks (geb. 1716 in Tolks), ab 1753 Kanzler in Preußen. Hier gab es einen wegen seiner Schönheit gerühmten Gutspark, der an die Kasseler Wilhelmshöhe erinnert haben soll. Die Gutsbesitzer wurden auf einer von Linden bestandenen Anhöhe im Park, dem sog. Fürstensitz, begraben.
[1] Hans-Georg Klemm, Vergessene und verschwundene Orte, Unser schönes Samland, Winter 2020, S. 31
[2] Unser schönes Samland, September 1965, S. 7
[3] Hans-Georg Klemm, Wiekau-Willgaiten, Unser schönes Samland, Winter 2020, S. 30 f
[4] Hans-Georg Klemm, Vergessene und verschwundene Orte. Heute – Gemeinde Drebnau, Unser schönes Samland, Winter 2022, S. 56 f