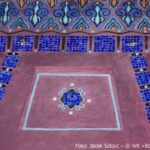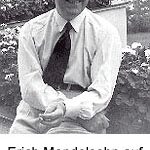Erich Mendelsohn (21. 3. 1887 – 15. 9. 1953), Architekt, wurde in Allenstein in einem Haus am Alten Markt als 5. Kind des begüterten jüdischen Kaufmanns David Mendeslsohn und seiner Ehefrau, der Hutmacherin Emma Esther, geboren. Der Vater hatte hier ein Geschäft für Herrenbekleidung und Lederwaren. Erich besuchte das humanistische Gymnasium in Allenstein, machte eine kaufmännische Lehre in Berlin und begann dann ein Studium der Volkswirtschaftslehr in München. Nach zwei Jahren wechselte er jedoch an die Könniglich Technische Hochschule in Berlin, um Archhitektur zu studieren. In dieser Zeit pflegte er Kontakte zu Mitgliedern der „Brücke“ und des „Blauen Reiters“. Als freier Architekt erst in München, nach dem 1. Weltkrieg in Berlin, entwarf er etliche auch heute noch beeindruckende Bauten, so den Einstein-Turm in Potsdam für das Astrophysikalische Institut als sein wohl bekanntestes Werk (1920 – 1924), die Jüdische Leichenhalle in Allenstein (1911 – 1913), die Haupteingangsfront des Mosse-Hauses in Berlin-Mitte, Schützenstraße Ecke Jerusalemer Straße (1921 – 1923). Zur Unternehmerfamilie Gustav Herrmannn unterhiellt er familiäre Kontakte, die zum Auftrag für die Hutfabrik der Firma Friedrich Steinberg Herrmann & Co in Luckenwalde mit Färbereigebäude führte (1921). Das UFA-Filmtheater am Lehniner Platz in Berlin, heute Theater der Schaubühne (1928), isr sein Werk, einige Kaufhäuser in Nürnberg, Chemnitz, Stuttgart, Breslau, die Loge der Drei Erzväter in Tilsit (1925/26), fertigte „De la Warr Pavilion“ in Bexhill-on-Sea zwischen Hastings und Brighton (1935). 1926 gründete Mendelsohn zusammmen mit Mies van der Rohe und Hugo Häring den „Ring“, einen Zusammmenschluß progressiver Architekten der Moderne. In der Zeit der Weimarer Republik beschfätige er in seinem Architekturbüro bis zuu 40 Mitarbeiter.[1] Das 1930 eröffnete Kaufhaus Schocken in Chemnitz wird nach der Wende Sitz des sächsischen „Haus der Archäologie“. Es hatte auf wundersame Weise den 2. Weltkrieg trotz seiner Innenstadtlage überstanden.
Nachdem Mendelsohn noch 1931 in die Akademie der Künste berufen worden war, musste er 1933 emigrieren. Sein inzwischen nicht unbeträchtliches Vermögen wurde beschlagnehmt. Er ging nach England, dann nach Israel und 1941 schließlich in die USA, wo er letztlich einem Krebsleiden erlag. 1997 wurde in Allenstein an seinem Geburtshaus an der Ecke ul. Prosta/Sw. Barbary (Oberstraße Ecke Oberkirchenstraße) am Alten Markt eine zweisprachige Gedenktafel angebracht, die an den großen Architekten erinnert. Ebenfalls eine Gedenktafel erinnert an seinen Wohnsitz in Berlin, die von ihm gebaute Villa in der Straße Am Rupenhorn 6 in Spandau.
Die Jüdische Leichenhalle, das “Haus der Reinigung“ oder „Bet Tahara“, von 1913 in Allenstein war sein erstes Projekt überhaupt. Er plante es noch während seiner Studienzeit und eröffnete es persönlich am 5. September 1913[2]. Es gleicht einem Wunder, dass sie noch steht, aber ihr Zustand war erbarmungswürdig. Vor dem 2. Weltkrieg wurde die Leichenhalle von den Nazis geplündert, nach dem Krieg befand sie sich in staatlicher Verwaltung und diente als Staatsarchiv. Die schön verzierten Wände wurden mit Ölfarbe überstrichen. Ab 1996 blieb das Gebäude ungenutzt und verfiel zunehmend. Seit Januar 2005 pachtete die Kulturgemeinschaft Borussia die Leichenhalle und sammelt Geld, um ihr die einstige Schönheit zurück zu geben. Im Innern ist bereits einiges geschehen. Der Hauptraum wird von einem pyramidenförmigen Dach überwölbt, in dessen Mitte ein goldener Davidstern angebracht ist. Gesimse und Pfeiler wurden mit schwarzem Putz und teilweise mit grünen Glasmosaiken ausgestattet. Es ist der Raum für die Feierlichkeiten. Die angrenzenden, mit Türen abgeteilten beiden Räume waren für den Rabbi und die eigentliche Vorbereitung des Leichnams vorgesehen. Nach der Sanierung beabsichtigt man, hier ein Zentrum für den interkulturellen Dialog einzurichten. – Inzwischen ist das Gebäude innen und außen instandgesetzt. Am 21. März 2013, dem 126. Geburtstag von Erich Mendelsohn, wurde die hervorragend restaurierte Anlage feierlich wiedereröffnet. Das Gärtnerhaus dient zukünftig als Sitz der Kulturgemeinschaft “Borussia”.[3]
Auch die würdevolle Gestaltung des einstigen, 1818 angelegten jüdischen Friedhofs nimmt langsam konkrete Formen an In den 50er und 60er Jahren wurden die Gragbsteine zu Teilen von Brunnen und Mauern verwendet.[4]
Literatur:
- Monographie „Gebaute Welten“, Hrsg. Regina Stephan, GHatje Cantz Verlag, 344 Seiten, 343 Abb., 68 Euro
- „Luise und Erich Mendelsohn, eine Partnerschaft für die Kunst“, Hrsg. Ita Heinze-Greenberg und Regina Stephan, 176 Seiten, 45 sw Abb., brosch., 25 Euro)
- [1]Martin Stolzenau, Ein Weltstar der Architektur aus Ostpreußen, PAZ Nr. 38/2023 (22. September), S. 11
- [2] Arkadiusz Luba, Storchennest, Januar 2014, S. 39
- [3] Uwe Hahnkamp, Ein Bau zweimal dreidimensional, Oprbl. Nr. 15/2013 (13. April), S. 13
- [4] Alexander Bauknecht, in Allensteiner Nachrichten, 24. 10. 2009, S. 3/4