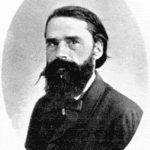Ferdinand Gregorovius (19. 1. 1821 – 1. 5. 1891) wurde in Neidenburg in eine Familie hinein geboren, zu der Pfarrer und Juristen gehörten. Sein Vater Ferdinand Timotheus Gregorovius (1780 – 1848) aus Gonsken, Kreis Treuburg, war ab 1809 Kreisjustizrat in Neidenburg. Er hatte die Tochter Wilhelmine des Kreisrats Kausch aus Schaaken bei Tilsit geheiratetl. Nach Besuch des Gymnasiums in Gumbinnen 1832 – 1838 studierte Ferdinand bis 1841 Theologie und Philosophie an der Albertina, fand aber, dass er sich für den Beruf des Pfarrers weniger eignet. Deshalb studierte er weiter und beendete es 1843 mit einer Dissertation zur Ästhetik Plotins. Danach war er zwei Jahre lang Hauslehrer in der Provinz und dann bis 1852 Lehrer an einer Privatschule in Königsberg. Gleichzeitig arbeitete er als Redakteur für die „Neue Königsberger Zeitung“. In dieser Zeit entstand 1848 sein Werk „Die Idee des Polenthums. Zwei Bücher polnischer Leidensgeschichte“. Als Redner auf Bürgerversammlungen nahm er aktiv am politischen Leben teil und 1849 wurde er einer der drei Königsberger Delegierten auf dem ostpreußischen „Provinzialkongress zur Wahrung des verfassungsmäßigen allgemeinen Wahlrechts“ nachdem die Restauration das Dreiklassenwahlrecht verfassungswidrig eingeführt hatte,
Als die restaurativen Kräfte in Preußen sich durchgesetzt hatten, war Gregorovius desillusioniert, und da er beruflich an der Universität auch nicht Fuß fassen konnte, fühlte er sich in einer Sackgasse gefangen. In dieser Situation war das Geschenk von 300 Talern Reisegeld seines Freundes Ludwig Bornträger ein Geschenk des Himmels. Im Jahr 1852 reiste Ferdinand Gregorovius nach Italien und ließ sich nach Korsika übersetzen, das er drei Monate lang durchwanderte. Anschließend arbeitete er in Rom seine Reiseaufzeichnungen aus. In Rom war er höchst erfolgreich wissenschaftlich und schriftstellerisch tätig. Unter etlichen Landschaftsbeschreibungen befand sich auch der Bericht „Sommeridyllen vom samländischen Ufer“ über die Küste des Samlands, die er noch 1852 bereist hatte.
1854 fasste er den Entschluss, die mittelalterliche Geschichte Roms darzustellen – daran arbeitete er die folgenden 18 Jahre. Basis war ein umfangreiches Quellenstudium und die persönliche Anschauung, denn Rom war damals noch stark vom Mittelalter geprägt. Er wurde damit zu einem der meistgelesenen deutschen Historiographen der damaligen Zeit. Als die ersten Bände erschienen, erhielt er sogar 10 Jahre lang ein Stipendium des Preußischen Staates in Höhe von 400 Talern jährlich. Von 1856 – 1877 veröffentlichte er 5 Bände seines Werks „Wanderjahre in Italien“ und von 1859 – 1872 seine bekannteste Schrift, die 8bändige „Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter“. 1874 siedelte er nach München über und wurde 1875 Mitglied der Bayrischen Akademie der Wissenschaften. 1876 wurde er der erste deutsche Ehrenbürger Roms und Mitglied der römischen Accademia dei Lincei. Eine Gedenktafel an seinem römischen Wohnsitz in der Via Gregoriana erinnert noch heute an sein Leben in der Stadt am Tiber. Neben jährlichen Aufenthalten in Rom unternahm er 1880 und 1882 ausgedehnte Reisen nach Griechenland und in den Orient. An seinem neuen Wohnort veröffentlichte er 1874 seine „Lukrezia Borgia“ und 1889 die „Geschichte der Stadt Athen im Mittelalter“.
Ferdinand Gregorovius blieb unverheiratet. Sein Vermögen und die Honorare aus seinen Schriften hinterließ er seiner Geburtsstadt Neidenburg mit der Auflage, für seinen um die Erhaltung der Burg verdienten Vater Ferdinand Timotheus Gregorovius ein Denkmal zu errichten sowie es zur Ausbildung armer Kinder ohne Ansehen der Konfession zu verwenden. Der Teil des Nachlasses, der im Neidenburger Rathaus aufbewahrt wurde, fiel dem Brand des Rathauses bei der Beschießung Neidenburgs im August 1914 zum Opfer.[1] Das Denkmal wurde in Form einer halbrunden Mauer mit zentralem Mittelstück gebaut und 1912 feierlich eingeweiht. Es erinnerte an Vater Timotheus Gregorovius, wie dekretiert, aber auch an seine beiden Söhne Ferdinand und Julius, deren Urnen eingemauert wurden. Der Entwurf für das Denkmal stammte von Maurermeister und Stadtverordnetenvorsteher Emil Schulz (1852 – 1932) und wurde ausgeführt von Maurermeister Alfred Kardinal (1859 – 1925). Es kam gut über beide Weltkriege. Ein geplanter Abriß 1966 konnte verhindert werden und Anfang der 1990er Jahre wurde das Denkmal restauriert.
Der ältere Bruder, Julius Gregorovius, wurde Offizier, dabei Regimentskommandeur 1870/71, und schrieb eine Geschichte Neidenburgs: Die Ordensstadt Neidenburg in Ostpreußen (1883). Auch er wurde Ehrenbürger seiner Heimatstadt.
Vater Timotheus Gregorovius setzte durch, dass die im Verfall begriffene Ordensburg der Stadt ab 1828 restauriert wurde. Im Sockel des vom Sohn gestifteten Denkmals unterhalb der Burg verwahrte man bis 1945 die Urnen mit der Asche von Ferdinand und seinem Bruder Julius Gregorovius. Die Urne von Ferdinand Gregorovius war zunächst in der Schloßkapelle der Burg Beichlingen aufbewahrt worden, da der Historiker mit dem damaligen Schloßherrn Graf Georg von Werthern-Beichlingen eng befreundet war und wurde erst 1911 auf inständiges Bitten des Neidenburger Bürgermeisters Kuhn nach Neidenburg überführt. Nach 1945 fand sich die Urne, aber ohne Asche, im Rathaus von Neidenburg an. Sie wurde 1986 neben die Gedenktafel seiner Vorfahren im Tor des Neidenburger Ordensschlosses eingemauert.
Die Grabplatte blieb jedoch in Beichlingen, wurde nach 1990 unter Gerümpel zutage gefördert und bildete den Kern einer Ausstellung zu Gregorovius, die aus diesem Anlass damals dann in Beichlingen stattfand. Sie trägt die Inschrift: „Hier ruhen die sterblichen Überreste von Ferdinand Gregorovius, dem deutschen Historiker und Bürger Roms. 19. Januar 1821 – 1. Mai 1891“ und wurde in die Mauer der Schlosskapelle eingefügt.
Ferdinand Gregorovius war trotz seines jahrzehntelangen Aufenthalts in Rom seiner Heimatstadt Neidenburg und deren Ordensburg stets verbunden. Er schrieb dazu in sein Tagebuch (11. 12. 1864): „Das ehrwürdige Schloss war ein großer Faktor in meiner kleinen Lebensgeschichte – es geht davon ein Bezug auf die Engelsburg in Rom. Ohne jene Neidenburger Rittertürme hätte ich vielleicht die ‚Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter’ nicht geschrieben“[2]. Und er hinterließ uns folgendes Gedicht:
Schloß Neidenburg
Die alte Burg der Neide
der Heimat Stolz und Freude
sie will ich preisen hoch.
Ich bin aus ihrem Turme
ein Falk, der sich im Sturme
ins weite Land verflog.
Die Türme, die da ragen
aus alten Rittertagen
so fest und trutziglich,
sie waren meine Meister,
die deutschen Heldengeister,
die einst erzogen mich.
Ein ahnend Weltbesinnen
war’s, das von jenen Zinnen
mir in die Seele floß;
was ich gesagt, gesungen,
hat sich hervorgeschwungen
aus Dir, Du Vaterschloß![3]
Ich werd’ dich nimmer sehen,
Auf grünem Berg nicht stehen
Am dunkeln Eichenbaum;
Nicht sehen die Wolken reisen,
Die Schwalben dich umkreisen
Wie sonst im Kindheitstraum.[4]
[1] H.K., Ferdinand Gregorovius und Ostpreußen, Neidenburger Heimatbrief, Pfingsten 1999, S. 37
[2] Hanna Schönherr, Ferdinand Adolf Gregorovius, Masurische Storchenpost Nr. 11/06
[3] Dr. Max Meyhöfer, Der Kreis Neidenburg, Thomann’sche Buchdruckerei Landshut 1968, S. 4
[4] H.K., Ferdinand Gregorovius und Ostpreußen, Neidenburger Heimatbrief, Pfingsten 1999, S. 35 f