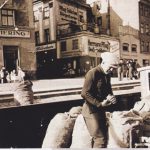Im Großen Moosbruch entstanden ab dem 16. Jh. Dörfer – Lauknen, Schöndorf, Mauschern, Sussemilken– mit Lehmböden, auf denen man Ackerwirtschaft betreiben konnte. Die Randgebiete des Hochmoors wurden vom Staat langfristig verpachtet. Diese Pächter kultivierten das Land, indem sie Entwässerungsgräben anlegten. Von hier aus wurde das Moor urbar gemacht. Es entstanden weitere Siedlungen und man begann mit dem Kartoffelanbau, wobei die „blaublanke Kartoffel“ mit ihrer glänzenden, fast durchsichtigen lila Schale ein landwirtschaftliches Spitzenprodukt darstellte. . Sie galt als die wohlschmeckendste Kartoffel überhaupt, weshalb die „Blanken“ auch Atlas-Kartoffeln genannt wurden. Sodann gab es Speisezwiebeln und Gemüse, aber wenig Viehzucht.
Beim Kartoffelanbau entwickelten die Moosbruchbauern ein spezielles Verfahren: sie legten Kartoffeln nicht, wie allgemein üblich, in Löcher im Acker, sondern bauten Dämme – 50 cm hoch, 120 cm breit, brachten kräftig Stallmist oben auf und pflanzten vorsichtig zwei Reihen der meist vorgekeimten Kartoffeln in dieses Acker-Mist-Gemisch. Da die moorigen Böden über einen hohen Grundwasserstand verfügten, kam das gelegte Pflanzgut aus dem kühlen Erdbereich heraus und wurde von drei Seiten des Dammes von der Sonne beschienen. Dadurch erwärmten sich die Pflanzen schneller, ihr Wachstum begann unmittelbar nach der Pflanzung. Ende Juni/Anfang Juli konnte man bereits die Kartoffeln ernten und war damit als erster auf dem Markt. Die so angebauten Kartoffeln waren von hoher Qualität und eigneten sich insbesondere als Salatkartoffel. Sie hießen Blaue Blanke, Blanke Blaue, Blaue Kartoffel und Moosbruchkartoffel. Die interessante Anbaumethode der Moosbrüchler wurde in unseren Tagen wiederentdeckt und heißt heute “Dammvorformung mit Entsteinung”.[1]
Eine der großen Moorkolonien war die Moorkolonie Bismarck . Sie war zwischen Heydekrug und Ruß gelegen und entstand ab 1835. Eine erste Schule wurde 1878 gebaut, eine zweite 1886, was die Vitalität der Einwohner demonstriert. Davon ist nicht viel geblieben. Heute sollen noch 10 Familien in Bismarck leben und die Häuser befinden sich in einem beklagenswerten Zustand.[2]