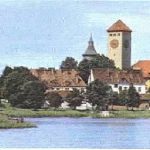Geschichte der Stadt Szczytno – Ortelsburg
Der aus nur schwer durchdringbaren Wäldern bestehende südöstliche Teil des Ordenslandes kam erst seit der 2. Hälfte des 14. Jhs. in das Blickfeld der Kolonisatoren, als man, von der Küste ins Binnenland vorstoßend, in dieser Gegend anfing, eine systematische Besiedlung zu betreiben. Um 1350 – 1360 wurde das feste „Hauß Ortelßburgk“ als Holz-Erde-Werk auf einer Halbinsel des Haussees – jez. Dlugie angelegt, um einen Pfleger aufzunehmen. Namensgeber war der Großgebietiger und Oberste Spittler Ortulf von Trier (1349 – 1371 oder 1373), Komtur von Elbing, als erster Hausherr ist der Pfleger Heinrich Murer belegt.
In der Nähe dieses Stützpunktes, auf der Nordseite des Sees, erhielten in dieser Zeit Einwanderer aus Masowien Siedlungsgelände zugewiesen, denn nach der ersten Einwanderungswelle aus dem Reichsgebiet im Westen bestand jetzt Mangel an deutschen Zuwanderern. Die Neuankömmlinge widmeten sich hauptsächlich der Imkerei, weshalb sich diese älteste Siedlung Beutnerdorf nannte. Sie hatte bis ins 19. Jhs. hinein mehr Einwohner als die Niederlassung unmittelbar um die Burg herum und wurde erst 1913 nach Ortelsburg eingemeindet.
Die Litauer unter ihrem Anführer Kynstut zerstörten die Ortelsburg 1370. Sie wurde umgehend wieder aufgebaut, diesmal in Stein. Trotzdem hielt sie dem Ansturm der Polen nach der Schlacht bei Tannenberg 1410 nicht stand und in der Periode des Bürgerkriegs zwischen dem Orden und dem Preußischen Bund, dem Städtekrieg (1454 – 1466), wechselte mehrfach der Besitzer.
Bei der Umwandlung des Ordensstaates in das Herzogtum Preußen wurde der Pfleger des Ordens abgelöst von dem herzoglichen Amtshauptmann, und der war zunächst dem Oberländischen Kreis zugeordnet. Zum Verwaltungsbereich gehörten die Ämter in Ortelsburg, Mensguth, Willenberg und Friedrichsfelde.
Als die Differenzen mit Polen nach Beendigung des Reiterkrieges (1519 – 1526) beseitigt waren, die Wildnis aber immer noch das Land prägte, wurde die Ortelsburg als Ausgangspunkt für die herzoglichen Jagden interessant. Herzog Albrecht bevorzugte zwar das kleinere Jagdschloß bei Puppen. Der Regent Herzog Georg Friedrich von Brandenburg, der bei seinem ersten Besuch entsetzt gewesen sein soll über den baulichen Zustand, gab der Ortelsburg den Vorzug und ordnete ihre gründliche Renovierung an.. Um diese Zeit – 1581 – begann die offizielle Besiedlung neben dem Schloss und dieses Jahr gilt als Gründungsdatum für Ortelsburg, so dass 1981 die 400-Jahr-Feier abgehalten werden konnte.
Die Einwohner waren Ackerbürger, Imker, Holzarbeiter, Fischer, aber auch einige der hier sesshaft gewordenen Handwerker, die am Ausbau des Jagdschlosses beteiligt gewesen waren. In dieser Periode verhaltenen, doch stetigen Wachstums erhielt Ortelsburg 1616 von Kurfürst Johann Sigismund zwar noch nicht das in Aussicht gestellte Stadtrecht – was der Konkurrent Passenheim, bereits Stadt, wohl befürchtete, aber immerhin das „Fundationsprivileg“ als Urkunde über die rechtliche Selbständigkeit, noch ohne das Amt des Bürgermeisters und ohne die Erlaubnis, regelmäßige Markttage veranstalten zu dürfen, aber mit der Zusage des Braurechts, wenn auch mit dem Wermutstropfen, „jährlich 20 Last Amtsbier zu verschenken“. Das Vorrecht des Bierbrauens war schon um 1600 vom Amtshauptmann Andreas zu Eulenburg gewährt worden und die nunmehrige offizielle Bestätigung war ein Siegpunkt im Wettstreit mit der Stadt Passenheim um die wirtschaftliche Vorherrschaft in der Region. Die Stadtrechte erhielt Ortelsburg dann 1723 unter König Friedrich Wilhelm I. als Kommune mit gerade 400 Einwohnern.
Beim Einfall der Tataren 1656 während des zweiten schwedisch-polnischen Krieges blieb zwar das Schloss uneingenommen, aber die Siedlung wurde erheblich zerstört, viele Einwohner grausam getötet. Weitere Opfer forderte die große Pest, die 1709 – 1711 reiche Ernte in Ortelsburg hielt.
Einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangte das 1744 gegründete Feldjägerkorps, das in der Stadt in Garnison lag und sich unter der Bezeichnung „Ortelsburger Jäger“ einen guten Ruf als Kundschafter und Wegweiser, aber auch als Scharfschützen erwarb.
Das preußische Königspaar hielt sich 1806 auf seiner Flucht vor Napoleon über Küstrin, Graudenz und Osterode längere Zeit vom 21. November bis 9./10. Dezember in Ortelsburg auf. Von hier aus verbreitete König Friedrich Wilhelm III. am 1. Dezember sein „Publicandum an die Armee und das deutsche Volk“, in dem die geplanten Maßnahmen zur Erneuerung der Armee nach den Niederlagen gegen Napoleon dargestellt waren, und in dieser Zeit war es, als Königin Luise der Überlieferung nach den ersten Vers eines Goethe-Gedichts mit einem Diamantring in eine Fensterscheibe einritzte: „Wer nie sein Brot mit Tränen aß …..“
Bei der großen preußischen Verwaltungsreform 1818 wurde Ortelsburg das Verwaltungszentrum eines der größten ostpreußischen Landkreise. Auch wenn hier auf dem Marktplatz vor dem Rathaus die seinerzeit berühmten masurischen Markttage abgehalten wurden, zählte der Kreis Ortelsburg zu den ärmsten Regionen in Preußen. Daran änderte auch der Eisenbahnanschluss 1883 nicht viel. Etliche Bewohner des umliegenden Landes, aber auch der Stadt wanderten deshalb um 1900 ins Ruhrgebiet aus, wo man in den Kohlezechen, insbesondere um Gelsenkirchen, Arbeit fand. Gelsenkirchen erhielt dabei zeitweise den Beinamen „Klein-Ortelsburg“.
Im Jahr 1884 verlegte man das Lehrerseminar, in dem vornehmlich Lehrkräfte für den ländlichen Bereich ausgebildet wurden, von Friedrichsdorf nach Ortelsburg, wo es ein repräsentatives Gebäude in der Hauptstraße nahe dem Markt erhielt. Das Seminar mußte 1914 seine Tätigkeit einstellen, weil die Lehrräume im 1. Weltkrieg zerstört wurden. In das wieder aufgebaute Haus zog in den 20er Jahren das Hindenburggymnasium ein.
Die gravierenden Zerstörungen des 1. Weltkriegs konnten in einer anschließenden Aufbauphase und mit Hilfe der Patenschaften von Berlin und Wien rasch wieder behoben werden, was nach dem 2. Weltkrieg nicht mehr möglich war.
Seit 1995 konnte man Ortelsburg relativ bequem mit Charterflugzeugen erreichen, weil der ehemalige Miltärflughafen von Szymany – Groß Schiemanen für Zivilflüge zugelassen wurde. Es gab zumindest noch 2001 wöchentliche Verbindungen von verschiedenen Flughäfen in Deutschland aus. Im Jahr 2013 wurde der Flughafen in das Register der zivilen Flughäfen eingetragen. Im Juni erging die Umweltverträglichkeits-Entscheidung[2] und dann wurde ein moderner und leistungsfähiger Flughafen neu gebaut. er Flughafen Olsztyn – Mazury wurde sodann gebaut und nahm am 21. Januar 2016 den Flugbetrieb auf. Der Flughafen Olsztyn – Mazury nahm am 21. Januar 2016 den Flugbetrieb auf.
Etwa 2 km von Ortelsburg entfernt befindet sich der Ort Corpellen, seit 1928 Korpellen
In Ortelsburg wurde der masurische Lyriker, Essayist und Übersetzer Richard Anders (25. 4. 1928 – 24. 6. 2012) geboren, dessen Roman „Ein Lieblingssohn“ stark autobiographische Züge trägt. Er war Deutsch-Dozent sowie Archivlektor beim „Spiegel“ und bei der „Welt“ und lebte zuletzt in Berlin. Er veröffentlichte sechs Gedichtbände, zuletzt 1998 „Die Pendeluhren haben Ausgangssperre“. Er wurde 1998 mit dem Wolfgang-Koeppen-Preis der Hansestadt Greifswald und erhielt am 29. Juni 2007 von der Akademie der Künste in Berlin den mit 5000 Euro dotierten F.-C.-Weiskopf-Preis.[1]
Der Schriftsteller Wolfgang Koeppen (23. 6. 1906 – 15. 3. 1996) verlebte prägende Jahre seiner Jugend in Ortelsburg. Geboren wurde er in Greifswald als unehelicher Sohn einer Näherin und des Augenarztes Reinhold Halben, der aber von seinem Sohn nichts wissen wollte. 1908 zog die Mutter nach Thorn zu ihrer Schwester und folgte ihr nach Ortelsburg, wo Wolfgang das Realgymnasium besuchte. 1919 zog die Familie zurück nach Greifswald. Wolfgang Koeppen wurde Laufbursche einer Buchhandlung, Volontär am Greifswalder Stadttheater und dann Schiffskoch. Er las gerne und fühlte sich zum Theater hingezogen. Hier gab es ernsthafte Begegnungen mit den Bühnen in Wismar und Berlin. Koeppen wandte sich jedoch dem Journalismus zu und wurde Redaktionsmitglied des „Berliner Börsen-Courier“, bis dieser gleichgeschaltet wurde. 1934 erschien sein erster Roman „Eine unglückliche Liebe“ bei Bruno Cassirer. Ein Jahr später folgte der zweite Roman „Die Mauer schwankt“. Bekannte Werke: „Tauben im Gras“ (1951); „Das Treibhaus“ (1953); „Der Tod in Rom“ (1954). Danach folgten Reisereportagen. 1962 erlitt er eine Schreibkrise, die nahezu bis zu seinem Tod anhielt. Marcel Reich-Ranicki hielt dennoch große Stücke auf ihn.
Werner Koepke aus Leiferde_nahe Gifhorn in Niedersachsen hat mit dem von ihm gegründeten Förderverein Masurenhilfe e.V. über viele Jahrzehnte regelmäßig jedes Jahr humanitäre Hilfslieferungen für Schulen, Kindergärten und Senioreneinrichtungen in Szczytno – Ortelsburg organisiert. Damit hat er sich große Verdienste bei den polnischen Einwohnern der Stadt erworben, die neben anderen Ehrungen und der Ehrenbürgerschaft von Szczytno einen Ausdruck in der Verleihung eines Ehrenpreises fand. Die Laudation, die aus diesem Anlaß gehalten wurde, führen wir nachfolgend auf. Die Laudation, die aus dem Polnischen übersetzt wurde, hielt Ryszard Gidzinski, Vorsitzender des PCK Szczytno:
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, Herr Werner, Damen und Herren Stadtverordnete, Verehrte Gäste!
Im Namen des Bezirksvorstands des Polnischen Roten Kreuzes in Szczytno – als Antragsteller – ist mir die besondere Ehre zugefallen, die Ansprache zu halten, die der Verleihung des Ehrenbürgertitels der Stadt Szczytno an Herrn Werner Koepke hervorgeht.
Der Mann, der in wenigen Augenblicken zum ersten Mal in der Geschichte unserer Stadt diesen Titel aus den Händen der Stadtvögte erhält, wurde geboren und lebt bis heutigem Tage im Bundesland Niedersachsen in Deutschland. Seine Beziehung mit Szczytno hat im Jahre 1993 angefangen, als er am 8. November mit einem Hilfsgütertransport für Schützlinge des Roten Kreuzes in Szczytno und für das Kinderheim (des heutigen Verbands der Betreuungs- und Erziehungseinrichtungen) angekommen war.
In den vergangenen 17 Jahren, bis zum 22 September 2010 einschließlich, hat Werner 78 Mal unsere Stadt besucht. Seine Hilfe hat erreicht – außer den schon genannten Einrichtungen – die Poliklinik, den Verein „Pro Publico Bono“, Städtisches Zentrum der Sozialhilfe in Szczytno, Woiwodschaftliche Verwaltung des Roten Kreuzes in Olsztyn, Überregionales Rehabilitation- und Bildungszentrum für Kinder und Jugendliche namens Johannes Paul II in Szczytno, viele Schulen des Kreises Szczytno, römisch-katholische Chrystus-Król-Pfarrgemeinde in Szczytno sowie viele Einzelpersonen in der Stadt, die man nicht aufzählen kann.
Die Hilfe umfasste viele Gebiete:
- im Bereich der Sozialhilfe: neue Bekleidung für Männer, Frauen und Kinder, Wäsche, Betten, Hygiene- und Waschmittel;
- im Bereich der medizinischen Hilfsmittel: Phantome, Verbandkästen, Verbandsmittel und Medikamente;
- im Sozialpflegerischen Bereich: Rollstühle, Krankenbetten, Matratzen zur Vorbeugung des Wundliegens, Gehstützen und –hilfen
- Einen beachtlichen Teil der Hilfstransporte stellen Lebensmittel dar.
- Seit 2002 gesellte sich dem Kreis der Beschenkten die Lazarus-Vereinigung der Humanitären Hilfe in Szczytno hinzu
- Der Verband der Betreuung- und Erziehungseinrichtungen in Szczytno bekam zwei Fahrzeuge: einen VW-Bus im Jahre 1995 und einen Ford-Escort 2005
- Die Woiwodschaftliche Verwaltung der Roten Kreuzes in Olsztyn erhielt im Jahre 1994 einen VW-Krankenwagen
- Auch die Wojciech-Ketrzynski-Integrationsgrundschule Nr.2 in Szczytno hat Herrn Werner viel zu verdanken.
Herr Koepke hat für seine uneigennützige Arbeit viele Bekannten aus seinem Wohnort Leiferde gewonnen. Er arbeitet seit 26 Jahren als selbständiger Versicherungsagent der Allianz AG. Zusammen mit seinen Freunden und Bekannten organisiert er Sammlungsaktionen und Pfandverlosungen, deren Erlöse zum Ankauf von zahlreichen Hilfsgütern bestimmt sind. Viele von seinen Helfern begleiteten ihn oft in den Reisen nach Szczytno. Für manche war es der erste Kontakt mit Polen, was bewirkte, dass später einige von ihnen auch alleine in unsere Gegend zum Urlaub kamen. Werner gastierte mehrere Male in Szczytno mit Ehefrau Isolde und mit den Kindern: Ronja und Jan.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Herr Werner Koepke hat einmal gesagt, dass er etwa anderthalb Jahre auf Fahrten und Aufenthalt in Polen verbracht hat. Die gefahrene Strecke zwischen Leiferde und Szczytno – abgesehen von beschwerlichen Fahrten zum Zollamt in Olsztyn zu Zeiten, als die Güter noch verzollt werden mussten (jede Zollabfertigung bedeutete einen verlorenen Tag) – beträgt: 78 x 1700 Km = 132600 Km, d.h. er hat mehr als 3 Mal die Erde entlang des Äquators umgekreist. Ich möchte betonen, dass Werner alle Transporte selber finanziert (Sprit und Versicherung).
Zum Beweis der Anerkennung seiner in Jahren gezeigten humanen Gesinnung hat das Hauptvorstand des Polnischen Roten Kreuzes in Warszawa ihn zwei Mal mit den höchsten Auszeichnungen des Poln.R.Kreuzes honoriert: mit dem Ehrenzeichen PCK der 3. und 2.Stufe und im Jahre 2009 mit der Gedenkmedaille 90 Jahre PCK.
Auf Antrag des Bezirksvorstandes PCK in Szczytno hat das Jurand-Kapitel im Jahre 2007 Herrn Koepke als erstem Ausländer die Ehren-Statuette Jurand zuerkannt für seine humanitäre Hilfeleistungen zu Gunsten der Einwohner der Stadt und des Kreises Szczytno.
In Gesprächen mit Herrn Werner Koepke spürt man die Freundlichkeit und das Gefallen an der Masurengegend und ganz besonders an der Stadt Szczytno. Er hat hier viele Freunde, unter welchen er sich wie zu Hause füllt. Seine besondere Zuneigung gilt dem Forsthaus Wikno bei Jerutki und dem Landwirtschaftsmuseum in Olszyny.
Über seine Feinfülligkeit für menschliche Schicksale zeugt folgender Fall:
Während eines seiner Aufenthalte in Szczytno im Jahre 2007 hat er zufällig vom Tod einer Angestellten der Stadtverwaltung erfahren. Unverzüglich hat er in einem örtlichen Supermarkt umfangreiche Einkäufe gemacht und diese den Kindern der Verstorbenen nach Hause (als Geschenk) gebracht.
Werner Koepke gehört zu fröhlichen, humorvollen und optimistischen Menschen obwohl ihm – wie auch vielen von uns – die Traurigkeiten nicht erspart werden: Sein Sohn Jan verunglückte im Jahre 2002 schwer und wird den Rest seines Lebens im Rollstuhl verbringen müssen. Der tragische Unfall des Sohnes hat ihn nicht gebrochen, er kommt weiterhin nach Szczytno gerne und mit Freude. Bei dieser Gelegenheit sollte vermerkt werden: mehrere Stadteinwohner nutzen die Rollstühle, die Werner Koepke nach Szczytno mitgebracht hatte.
Bei Überreichung der Medaille 90 Jahre PCK vor einem Jahr stellte der Landrat, Herr Jarosław Matlach, Herrn Koepke die Frage: wie lange beabsichtigen Sie noch nach Szczytno zu kommen? Herr Koepke antwortete in seiner Manier: so lange, wie lange ich mich noch hinter dem Steuer werde setzen können.
Sehr geehrte Damen und Herren,
das Polnische Rote Kreuz ist eine humanitäre Organisation, der irgendwelche Gliederung: sei es politische, konfessionelle, rassistische oder andere – fremd sind. Der Bezirksvorstand des PCK in Szczytno hat anfangs dieses Jahres beschlossen, diese hervorragende Tätigkeit im Bereich der Hilfeleistung dorthin, wo sie noch von vielen Menschen benötigt wird, zu würdigen. Hier geht es doch nicht nur um humanitäre Hilfe.
Herr Werner Koepke baut Verständigungsbrücken zwischen den Gesellschaften von Polen und Deutschland, verändert die immer noch existierenden Stereotype auf beiden Seiten der Grenze. Wir lernen von ihm – er von uns. Dies alles wird sich in Zukunft für beide Länder vorteilhaft auswirken im gemeinsamen Vereinigten Europa. Und eben Das verdient Würdigung.
Meine Damen und Herren Stadtverordnete,
ich danke Ihnen für die richtige Einschätzung unseres Antrages und positive Entscheidung darüber.
Lieber Werner, erlaube bitte, dass ich mich bei Dir noch einmal bedanke dafür, was Du für unsere Stadt und unseren Kreis getan hast. Ich danke Dir für Dein Großes Herz!
Die Auszeichnung, die Du gleich bekommen wirst, stellt den Beweis dar, dass die Einwohner von Szczytno auf diese symbolische Weise sich bei Dir bedanken möchten!
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.[3]